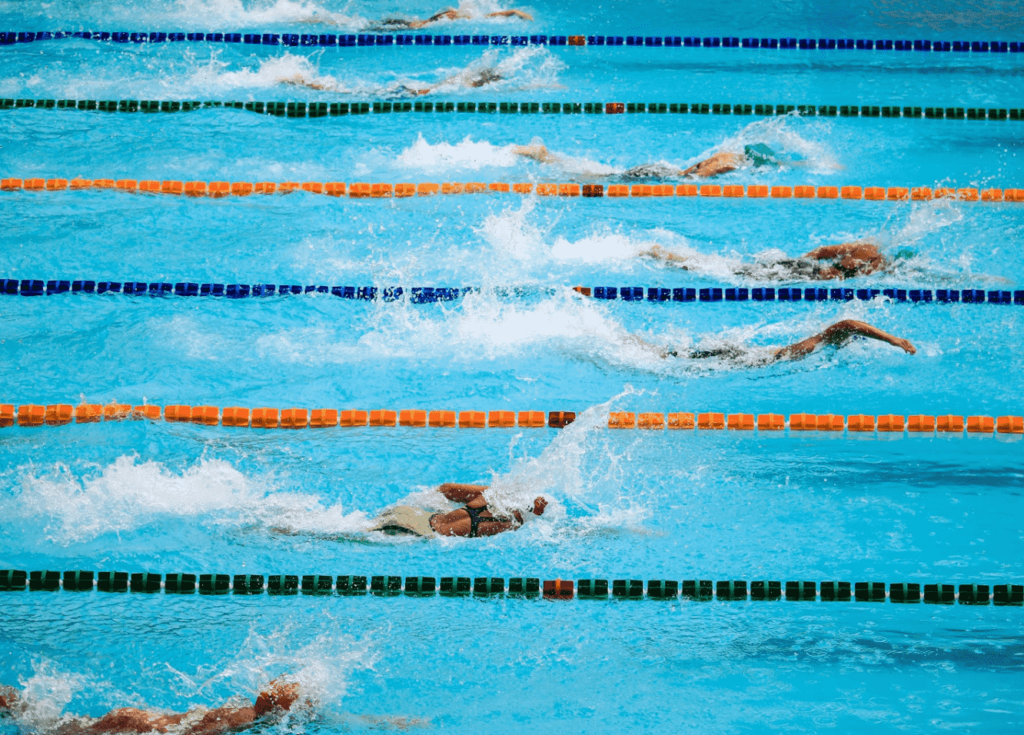Vor zweihundert Jahren war Armut in Deutschland weit verbreitet. Tausende Deutsche wanderten damals aufgrund eines verlockenden Angebots des brasilianischen Herrschers aus.

Aufgrund der Folgen der Napoleonischen Kriege, schlechter Ernten und hoher Steuern hatten es die Deutschen um die Wende zum 19. Jahrhundert schwer.
Nach und nach traf ein verlockendes Angebot aus aller Welt ein: 77 Hektar Land für Familien, die bereit waren, nach Brasilien umzuziehen. Zusätzlich gab es finanzielle Unterstützung für die ersten zwei Jahre, Saatgut, Tiere und landwirtschaftliche Geräte.
Viele deutsche Handwerker, Tagelöhner und Bauern hätten sich das in ihrer Heimat nicht erträumen können. Sie folgten der Aufforderung schnell und verließen ihr bisheriges Zuhause.
Expats in dieser alten portugiesischen Kolonie gesucht
Die Argus legte im Januar 1824 mit rund 280 Passagieren an Bord in Rio de Janeiro an. Dieses Schiff schrieb Geschichte, weil es als erstes Deutsche „im Dienste des brasilianischen Kaiserreichs“ transportierte. Sao Leopoldo, benannt nach der österreichischen Frau des brasilianischen Kaisers, Leopoldine, wurde am 25. Juli 1824 von den Neuankömmlingen gegründet, die sich zuvor in den Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul niedergelassen hatten. Entgegen der landläufigen Meinung hatte sie sich aktiv für die Entsendung von Deutschen nach Brasilien eingesetzt.
Nur zwei Jahre zuvor hatte das südamerikanische Land seinen Status als portugiesische Kolonie hinter sich gelassen. Daher war die Entscheidung Kaiser Dom Pedros I., die Einwanderer willkommen zu heißen, mehr als nur ein Zeichen des guten Willens. Er brauchte vor allem Siedler, die im Süden Brasiliens Landwirtschaft betreiben konnten, aber er wollte auch, dass sie kampfbereit waren, falls Brasiliens Feinde angreifen sollten.
Der Historiker Stefan Rinke vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin sagte: „Das Ende der Sklaverei war in Sicht, und es stellte sich die Frage, woher man neue Arbeitskräfte nehmen sollte.“ Aufgrund der zunehmenden Versorgungsengpässe aufgrund des britischen Sklavenhandelsembargos wurde den Menschen klar, dass die Sklaverei auf Dauer nicht aufrechterhalten werden konnte. Sie konzentrierten sich daraufhin auf die von Deutschland kontrollierten Gebiete. Dort lebten viele verarmte Menschen, und ihnen war bewusst, dass auch sie zur Flucht gedrängt wurden.
Brasiliens Ziel war es, seine Bürger „weißer“ zu machen
Die herrschende Klasse Brasiliens strebte damals eine „weißere“ Nation durch die Einwanderungspolitik an.
„Fortschritt wurde mit Europäisierung gleichgesetzt, sowohl der Sitten und Traditionen als auch der Bevölkerung im Besonderen“, so die DW. Man suchte Europäer. Und zwar nicht irgendwelche Europäer, sondern vor allem solche aus Mitteleuropa, da man sie als besonders bewundernswert ansah: ehrgeizig, gehorsam, moralisch und nicht zuletzt eine große Quelle potenzieller neuer Untertanen.
In den nächsten hundert Jahren werden sich rund 250.000 Deutsche in einem neuen Land niederlassen, das fast 6.200 Kilometer von ihrer ursprünglichen Heimat entfernt ist.
„Hier bekommen Sie ein Stück Land von der Größe eines Landkreises in Deutschland“, schrieb ein brasilianischer Pionier 1827 voller Begeisterung an seine Familie.
Die Pioniere benötigten viel Platz für ihre Behausungen, ihre Landwirtschaft und ihre Tiere. Die Neuankömmlinge fanden sich jedoch nicht in einem unbewohnten Wald wieder. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den neuen deutschen Neuankömmlingen und den Ureinwohnern, die das Gebiet bereits besiedelt hatten, da erstere um die Verteidigung ihrer Heimat kämpften.
Die Regierung begann rasch, Söldnertruppen einzusetzen, um die indigene Bevölkerung brutal auszulöschen. Der Verkehr zwischen Hochland und Küste werde durch die Bugre, ein abwertendes Wort für die Ureinwohner, versperrt, so der Urwaldboten, eine Zeitung aus dem 1850 gegründeten Blumenau. Diese Störung müsse sofort und vollständig beseitigt werden. Sentimentale Gedanken über die unfaire und moralisch ungerechtfertigte Jagd auf Bugre hätten hier nichts verloren. Eine Armee von Bugre-Jägern und Rangern müsse die Nomadenstämme zerstreuen, um sie alle auf einmal auszulöschen.
Versteckt in der Abgeschiedenheit
Weil sie den Jägern der Ureinwohner nicht gewachsen waren, kamen zwei Drittel der indigenen Bevölkerung um.
Im Gegensatz dazu waren die deutschen Kolonien recht erfolgreich. Die Neuankömmlinge bewahrten die Traditionen ihrer angestammten Nation und sprachen weiterhin Deutsch. Nur wenige konnten sich auf Portugiesisch verständigen, und die Siedler vermieden es, sich unter ihre neuen Nachbarn zu mischen. Die Einwanderer feierten weiterhin den Geburtstag des Kaisers und schickten großzügige Spenden ins Heimatland, selbst als sie im Ersten Weltkrieg kämpften.
Die brasilianische Bevölkerung war aufgrund dieser Isolation skeptischer, und die Warnungen vor der „deutschen Gefahr“ wurden lauter. Viele Einwanderer deutscher Abstammung begeisterten sich in den 1930er Jahren für Adolf Hitler, als die Nationalsozialisten in Deutschland an Einfluss gewannen. Tatsächlich war Brasilien die Heimat der größten Nazi-Partei außerhalb Deutschlands, und Schulkinder sangen dort Nazi-Lieder.
Schließlich bezog Präsident Getulio Vargas eine klare Haltung. Die NSDAP und die deutschsprachigen Medien wurden verboten, deutschsprachige Gemeinden aufgelöst und die Sprache selbst kriminalisiert.
„Der Grund dafür war, dass Brasilien in beiden Weltkriegen Deutschland den Krieg erklärt hatte. Es ging also auch um die innere Sicherheit.„, sagte Frederik Schulze vom Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin. Auch in Brasilien kam es zu Unruhen gegen deutsche Unternehmen in brasilianischem Besitz, nachdem deutsche U-Boote Schiffe versenkt hatten. Anders ausgedrückt: Der Konflikt hat die ganze Stimmung „neu entfacht“.
Nazi-Deutschland war 1945 zusammengebrochen, und die deutsche Kultur hatte einen Tiefpunkt erreicht. Deutschbrasilianer brachen den Kontakt zu ihrer Heimat ab. Sie assimilierten sich in die brasilianische Kultur, nachdem sie Portugiesisch gelernt hatten, und ihre Kinder taten dasselbe.
Einige deutsche Bräuche haben überlebt
Auch wenn südbrasilianische Deutschakzente immer häufiger werden, sind die Auswirkungen der deutschen Einwanderung noch heute spürbar. Touristen können Sauerkraut mit Schweinshaxe und Apfelstrudel genießen und dabei Fachwerkhäuser in der Gegend besichtigen.
Blumenau ist bekannt für eines der größten Oktoberfeste der Welt, nur München ist größer. Die Stadt wurde 1850 vom deutschen Apotheker Hermann Blumenau mitten im Regenwald gegründet.
Es scheint, als wäre dieser Trend von Anfang an falsch gewesen. Brasilianer wandern derzeit in umgekehrter Richtung nach Deutschland aus, wie Hunderttausende Deutsche vor zwei Jahrhunderten. Das deutsche Auswärtige Amt berichtet, dass derzeit rund 160.000 Brasilianer in Deutschland leben.