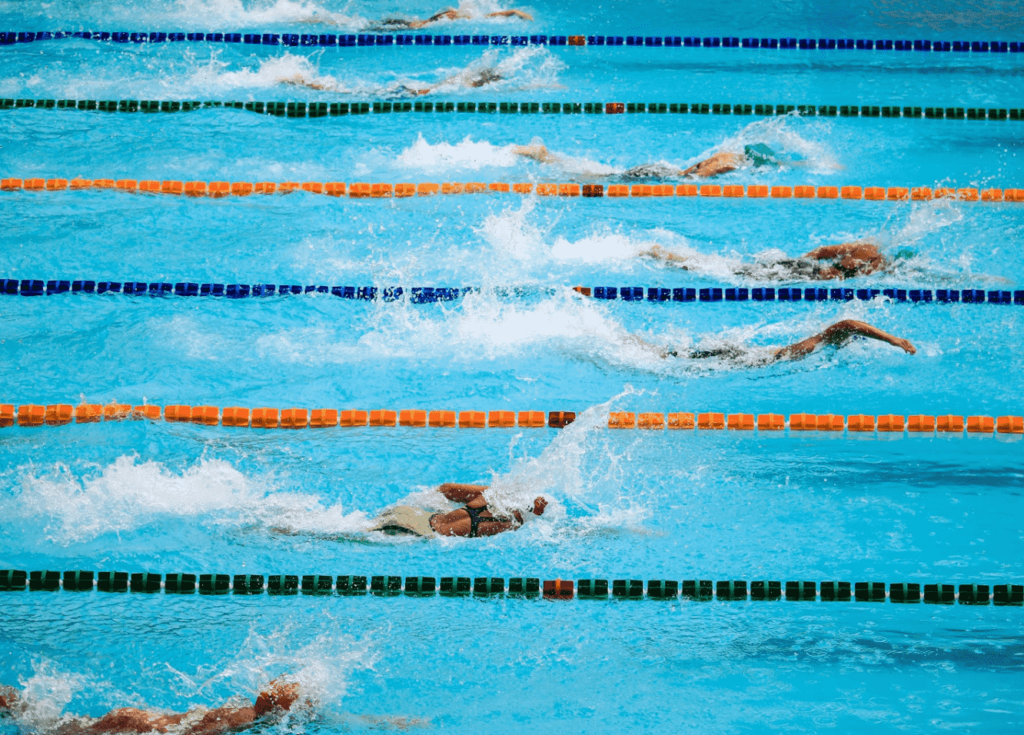Diese widerstandsfähigen Kreaturen mit wirrem Fell sind zu einem großen Teil für die unverwechselbare Identität der Färöer-Inseln verantwortlich, die sich von ihrem Namen „Schafinseln“ ableitet.

Ich öffnete einen kleinen Karton im Nationalarchiv der Färöer-Inseln in der Hauptstadt Tórshavn und betrachtete einen altertümlichen Band, der in Leder gebunden und durch die Verwendung im Laufe von Hunderten von Jahren poliert war.
Graf Hákon Magnússon, der ehemalige norwegische Herrscher der Färöer, erließ 1298 eine Gesetzessammlung namens Seyðabraevið (der Schafbrief). Dieses Dokument ist das älteste noch erhaltene Dokument des Landes. Darin ist auch die Höhe der Entschädigung festgelegt, die zu zahlen ist, wenn ein Mann seinem Hund erlaubt, die Schafe eines anderen zu jagen, der Herde eines Nachbarn Weideland wegnimmt oder ein verwildertes Schaf in die Herde eines anderen Hirten treibt und dadurch die „ruhigeren“ Tiere stört.
Ich lebte ein Jahr lang auf diesen dünn besiedelten Inseln und fühlte mich nie isoliert, als ich allein durch die dunklen, grünen Berge wanderte. Das lag daran, dass fast immer Vieh in Sicht war. Die dramatische Landschaft dieses abgelegenen, öden Landes wurde von diesen widerstandsfähigen, wirrhaarigen Tieren geformt, die seit über einem Jahrtausend die Hänge abgrasen, die außer Gras kaum Vegetation bieten. Dies hat auch die Identität des Landes geprägt.
Die 18 Vulkaninseln der Färöer, die im Nordatlantik zwischen Schottland und Island liegen, sind eine abgelegene, dynamische Region Skandinaviens. Sie zeichnen sich durch traditionelle Holzhäuser mit Torfbelag und das gleiche blitzschnelle, nahezu flächendeckende WLAN aus, das auch in anderen nordischen Ländern verfügbar ist. Darüber hinaus beheimaten sie tosende Wasserfälle, steile Klippen und atemberaubende Fjorde, die 2024 eine Rekordzahl an Reisenden anlocken werden.
Die Färöer-Inseln, die im 6. Jahrhundert n. Chr. von irischen Geistlichen besiedelt und im 9. Jahrhundert von Wikingern dauerhaft gegründet wurden, sind heute ein autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark. Die 54.000 Inselbewohner sprechen Färöisch, eine eng mit dem Altnordischen verwandte Sprache. Und sollte die Bedeutung der trittsicheren Schafe der Inseln für ihre nationale Identität unklar sein, so genügt ein Blick auf ihren färöischen Namen: Føroyar (die Schafinseln).
Neueren Forschungen zufolge gibt es auf den Färöer-Inseln seit der Ankunft der ersten irischen Siedler Schafe.
Die Wikinger, die Jahrhunderte später ankamen, benannten die Inseln nach den nordeuropäischen Kurzschwanzschafen, die sie in der Gegend entdeckten. Seit über einem Jahrtausend ist die Zucht halbwilder Schafe für Fleisch und Wolle sowie die Fischerei, Schleppnetzfischerei und Jagd auf Seevögel für das Überleben in diesem rauen, abgelegenen Land unerlässlich.
Früher wurden die Herden per Boot in bestimmte Regionen der Inseln transportiert und waren in der Regel gemeinschaftlich besessen, wie auch heute noch. Die meisten färöischen Familien besitzen noch immer einen Teil ihres Viehbestands, und zahlreiche Personen, darunter Ärzte, Anwälte, Handwerker und Lehrer, beteiligen sich an der Herbstschlachtung, um bei der Schlachtung zu helfen und das Fleisch gerecht zu verteilen. Heute hat fast jede färöische Familie das ganze Jahr über eine fermentierte Lammkeule in der Speisekammer.
Die Färöer sind die Heimat dieser rehäugigen Tiere, die man an verschiedenen Orten beobachten kann, unter anderem auf dem Parkplatz des einzigen Flughafens der Insel. Oft sieht man sie beim Wiederkäuen auf Kreisverkehren oder beim Knabbern an den Grasdächern historischer färöischer Gebäude. Tatsächlich ist der färöische Viehbestand von 70.000 Tieren auf den Inseln deutlich größer als die Bevölkerung der Färöer.
An bis zu 300 Tagen im Jahr regnet es, und die Färöer sind einigen der stärksten Winde Europas ausgesetzt. Die wichtigsten Nutzpflanzen, die auf diesem kargen Boden angebaut werden können, sind einige Kartoffeln, Radieschen, Karotten und Rhabarber. Daher sind fermentiertes Lamm- und Hammelfleisch unverzichtbare Bestandteile der Ernährung. Diese pikante Küche, Skerpikjøt, ist vom besonderen Klima der Färöer geprägt, das zwar windig, aber nie zu kalt oder zu mild ist.
Das Fleisch wird nach der Schlachtung im Herbst in Hjallur, Behältern, aufgehängt, wo es langsam getrocknet und von einer Schicht Mikroben besiedelt wird. Das Fleisch durchläuft verschiedene Phasen, darunter das Nasswerden (ræst), das Trocknen (turt) und schließlich die Fermentation (skerpi), bei der es einen kräftigen, cremigen Geschmack entwickelt. Die charakteristische Schwärzung des Fleisches ist laut Jógvan Páll Fjallsbak, Mikrobiologe bei der Lebensmittel- und Veterinärbehörde der Färöer, das Ergebnis der schnellen Entwicklung von Mikroben auf seiner Oberfläche.
„Wir wissen, dass auf der Oberfläche des Fleisches mehr als 600 Bakterienarten identifiziert wurden“, so
Wir sind jedoch noch dabei, die chemischen Prozesse, die den endgültigen Geschmack des Fleisches beeinflussen, umfassend zu verstehen. Dieser hängt von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Manchen Experten zufolge kann der Geschmack des Fleisches Rückschlüsse auf die Insel zulassen, von der es stammt.
Das Fleisch ist nicht der einzige wichtige Faktor. „Ull er Føroya gull“ ist ein altes färöisches Sprichwort, das übersetzt „Wolle ist das Gold der Färöer“ bedeutet. Das dichte, haarige Garn wird noch immer für traditionelle färöische Strickwaren verwendet, und Strickbetriebe gibt es in jedem Dorf. Das ganze Jahr über trägt der Großteil der Bevölkerung die charakteristischen färöischen handgestrickten Pullover.
Es überrascht vielleicht nicht, dass Schafe in einem Land, das ihren Namen trägt, zu einem Nationalsymbol geworden sind. Das Emblem des nationalen Tourismusverbandes ist ein Widderschädel. Black Sheep ist eine der bekanntesten Biermarken des Landes. Eine bronzene Widderstatue steht im Herzen von Tórshavn, wo 40% der Inselbevölkerung leben und acht der neun Verkehrsampeln des Landes stehen. Kinder, die sich auf seinem Rücken ausruhen, reiben das Metall gerne sauber, sodass das Geweih glänzt.
Es ist eines von zahlreichen Schafdenkmälern in der Hauptstadt, darunter eine Gruppe stilisierter Stahlschafe, die vor dem Kulturzentrum Nordisches Haus grasen und vom färöischen Bildhauer Rógvi Hansen geschaffen wurden.
Schafe versorgten die Färinger nicht nur mit Nahrung, Kleidung und Dach, sondern leisteten im Laufe der Geschichte auch weitere gesellschaftliche Dienste. 2016 produzierte die färöische Regierung eine Reihe von Filmen, die von Schafen mit Kameras gedreht wurden, um die touristische Attraktivität der Färöer zu steigern und, wie der Nordische Ministerrat es formulierte, „die Färöer der Welt vorzustellen“. Die Google-Street-View-Parodie wurde „Sheep View“ genannt, und Beamte behaupten, dass dies zu einer deutlichen Steigerung der touristischen Bekanntheit der Inseln geführt habe.
„Wir hatten uns vorgenommen, Sheep View humorvoll zu gestalten und glaubten, dass dieses unkonventionelle Konzept trotz unseres relativ bescheidenen Budgets die Fantasie der Besucher anregen würde“, erklärte Guðrið Højgaard, CEO von Visit Faroe Islands. „Wir legen großen Wert auf unsere Schafe, und sie sind ein so wesentlicher Bestandteil unserer nationalen Identität, dass es nur natürlich erschien, sie weltweit bekannter zu machen.“ Ich finde unsere Rinder auch sehr attraktiv.
In der Zwischenzeit berichtete Høgni Reistrup, der Inhaber des örtlichen Reisebüros „Guide to the Faroe Islands“, dass sie häufig Anfragen von Einzelpersonen aus aller Welt zu „Reiseroute rund um Schafe“ erhalten.
„Ich habe Anfragen von Kunden aus Ländern erhalten, in denen die Schafzucht eine wichtige Rolle spielt, wie etwa Neuseeland und Australien, und gefragt, ob ihnen ein Führer zur Verfügung steht, der sie zu einer Farm begleitet, wo sie mit einem färöischen Schäfer sprechen und sogar am Herbstabtrieb teilnehmen können.“ „Es ist eine besonders fotografiefreundliche Jahreszeit“, erklärte Reistrup.
Darüber hinaus können Touristen in Restaurants in Tórshavn, insbesondere im nahe dem Hafen gelegenen Ræst, Gerichte mit dem berühmten fermentierten Lammfleisch der Inseln probieren. Einige Bauern bieten im Rahmen des „Heimablidni“-Programms (Heimgastfreundschaft) auch traditionelle kulinarische Erlebnisse an. Schafzüchter Jákup Petersen bietet außerdem geführte Wanderungen auf seinem Land in der Nähe des Dorfes Kaldbak an, bei denen Besucher zu einer Berghütte wandern und dort windgetrocknetes Skerpikjøt-Lammfleisch von seinen eigenen Schafen probieren können.
Eva ur Dímun ist die achte Generation ihrer Familie, die auf der kleinen färöischen Insel Stóra Dímun Schafe züchtet. Sie lebt allein mit ihrem Ehemann JógvanJón und ihren rund 500 Schafen.
Nach einem anstrengenden Tag des Zusammentreibens des Viehs an den steilen Hängen der Insel sagte mir Ur Dímun: „Ich bewundere diese Tiere; sie sind so zäh und keine langweiligen Geschöpfe, wie viele Leute vielleicht denken.“ „Ohne Nahrung und Obdach können wir hier nicht überleben, da wir viel Energie darauf verwenden, die Schafe zu jagen.“ Ich empfinde ein Gefühl der Minderwertigkeit, wenn ich an ihre bemerkenswerte Anpassung an die Umwelt denke. Sie sind in der Lage, Kälber zu bekommen und den Winter mit pflanzlicher Nahrung zu überstehen, und sie trotzen Wind, Regen und Schnee.
Besucher des Nationalmuseums Tórshavn können in einer Glasvitrine eine winzige Familie dreier ausgestopfter brauner Schafe bewundern und so einen Einblick gewinnen, wie sich diese widerstandsfähigen Tiere an das besondere Klima der Färöer angepasst haben. Sie wurden im späten 19. Jahrhundert auf der unbewohnten Insel Lítla Dímun gefangen, die nur wenige Kilometer von der Farm der Ur Dímun entfernt liegt. Diese Schafe sind wesentlich kleiner und weniger wollig als die heutigen färöischen Schafe. Sie sind die letzten bekannten Exemplare der ursprünglichen färöischen Rasse, auf die die Wikinger bei ihrer Ankunft um das Jahr 800 n. Chr. auf den Inseln stießen. Im 19. Jahrhundert wurde die einheimische Rasse durch größere und schwerere Arten aus Schottland, Island und Norwegen verdrängt, um besseres Vlies und mehr Fleisch zu liefern.
Die Färöer waren das Ziel zahlreicher Siedler, von Wikingern über dänische Landbesitzer bis hin zu modernen Reisenden – allesamt von den Elementen angezogen. Doch die widerstandsfähigen Schafe haben überlebt und im Stillen die unverwechselbare Identität der Färöer geprägt, eine Nation geformt und das Land geprägt.
Tim Ecott ist der Autor des Buches „The Land of Maybe: A Faroe Islands Year“ und ehemaliger Korrespondent des BBC World Service.